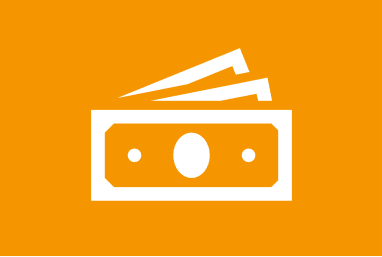Branchenbilder
Information und Kommunikation
Die Branche heute
Die Branche Information und Kommunikation ist eine wichtige Säule der deutschen Wirtschaft und ihre Produkte sind ein Baustein für die Digitalisierung in Deutschland. Die Bruttowertschöpfung der Branche legte in den Jahren von 2010 bis 2019 deutlich überdurchschnittlich zu. Mit einem jährlichen Wachstum der Bruttowertschöpfung von 4,9 Prozent liegt die Branche Information und Kommunikation nach DV-Geräte, Elektronik, Optik und Kraftwagenbau an dritter Stelle im gesamtwirtschaftlichen Branchenvergleich. Die durchschnittliche Wachstumsrate der Dienstleistungen lag bei lediglich 1,5 Prozent p. a. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Branche Information und Kommunikation eine Bruttowertschöpfung von 147 Milliarden Euro. Die Anzahl der Erwerbstätigen stieg mit 1,6 Prozent p. a. im gleichen Zeitraum ebenfalls überdurchschnittlich. Mit 1,3 Millionen Mitarbeitenden beschäftigte die Branche im Jahr 2019 im Vergleich mit den anderen Dienstleistungsbranchen wenig Personen. Die Branche Information und Kommunikation ist nicht exportintensiv. Als wichtige Vorleistungsbranche ist sie allerdings indirekt vom Exporterfolg von Unternehmen aus anderen Branchen abhängig.
Eine Besonderheit des Wirtschaftszweigs ist seine hohe Innovationsfähigkeit. Die sogenannte Innovatorenquote – der Anteil der Unternehmen, die in den letzten drei Jahren ein neues oder verbessertes Produkt oder einen neuen Prozess auf den Markt gebracht hat – lag 2019 bei 85 Prozent und war damit höher als in allen anderen Branchen. Gleiches gilt für die Gründungsrate – sie bemisst den Anteil von Neugründungen innerhalb eines Jahres an allen Unternehmen einer Branche: Sie lag 2019 bei 6,2 Prozent und somit ebenfalls über denen aller anderen Branchen.
Die COVID-19-Pandemie führte zu einem Digitalisierungsschub in vielen privaten, öffentlichen und geschäftlichen Bereichen. Davon hat die Branche grundsätzlich profitiert. Kurzfristig sah das Bild im Laufe des Jahres 2020 ambivalenter aus: Auf der einen Seite wurden IT-Dienstleistungen verstärkt nachgefragt, um den Geschäftsbetrieb in den Unternehmen und Verwaltungen aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite sank die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen in einigen exportorientierten Branchen, sodass besonders kleine Unternehmen und Selbstständige der Branche in wirtschaftliche Probleme gerieten.
Die Wettbewerbssituation
Die Wettbewerbsstruktur in der deutschen Informations- und Kommunikationsbranche ist sehr heterogen. Der Bereich Telekommunikation ist durch wenige größere Unternehmen geprägt, die den deutschen Markt unter sich aufteilen. Der Markt ist durch hohe Markteintrittsbarrieren gekennzeichnet und wird stark von der Bundesnetzagentur reguliert. In den letzten Jahren zeigt sich ein wachsender Einfluss von EU-Regularien wie z. B. die Abschaffung der Roaminggebühren innerhalb Europas.
Der Bereich der IT-Dienstleistungen dagegen besteht aus vielen kleinen Unternehmen. Dies ist u. a. auf die große Anzahl der Freiberufler*innen und Selbstständigen in diesem Bereich zurückzuführen. Insbesondere Startups versuchen, sich durch Innovationen von ihren Konkurrenten abzuheben. Großunternehmen wie Google und Amazon sind wichtige Marktteilnehmer, die insbesondere bei skalierbaren Dienstleistungen wie Cloudcomputing eine starke Marktposition haben. Im Bereich Informationsdienstleistungen ist das Outsourcing von Dienstleistungen ein wichtiges Thema. Zielländer sind oftmals Indien oder Osteuropa, weil dort hinreichend qualifizierte Arbeitskräfte zu relativ geringen Arbeitskosten zur Verfügung stehen.
Der Bereich Verlagswesen ist geprägt durch mittelgroße Unternehmen. Die Wettbewerbssituation ist für die Verlage durch digitale und internationale Konkurrenten in den letzten Jahren herausfordernder geworden.
Die wichtigsten Zukunftstrends
Die Branche Information und Kommunikation ist die originäre Branche der Digitalisierung. Künftig setzen insbesondere IT-Dienstleister auf individualisierte und flexiblere Produkte. Ein Beispiel hierfür sind selbstentwickelte Cloudlösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kund*innen ausgerichtet sind. In diesem Zusammenhang nähern sich IT- und Ingenieursdienstleistungen deutlich an, um Vernetzungstechnologien wie das Internet der Dinge bereitzustellen. Wachstumspotenzial bietet u. a. der weitere Ausbau der Dateninfrastruktur. So wird in Europa derzeit etwa das Projekt Gaia-X gefördert, bei dem eine dezentrale, aber einheitliche Dateninfrastruktur in Europa aufgebaut werden soll. Damit soll die Abhängigkeit von großen internationalen Anbietern aus den USA oder China verringert werden. Auch die Weiterentwicklung des mobilen Netzes inklusive des Aufbaus und der Entwicklung von 5G-/6G-Netzen verspricht ein wachsendes Geschäftspotenzial für die Unternehmen der Branche.
Im Teilbereich Verlagswesen bedeutet die Digitalisierung eine stärkere Konkurrenz durch internetbasierte Dienstleistungen, was die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle erzwingt. Besonders hoch ist der Transformationsdruck in den Bereichen Fernsehen und Kino. Hier ist mit dem Aufkommen der Streamingdienste neue Konkurrenz entstanden. Auch das Verlagswesen steht vor der Herausforderung, die Geschäftsmodelle z. B. durch neue Content-Formen zu modernisieren, etwa durch eine Kombination verschiedener Darstellungsformen der angebotenen Inhalte.
Darüber hinaus gewinnt das Thema Cybersicherheit an Bedeutung. Je mehr vernetzte Personen und Objekte es gibt, desto größer ist die Angriffsfläche für Hacker*innen und der damit verbundene potenzielle Schaden.
Die Zukunft der Branche in Zahlen
Der Wirtschaftszweig Information und Kommunikation hat ihre Kernbranche, die Digitalisierung, in den vergangenen Jahren maßgeblich gestaltet. Auch künftig sorgt die weiter zunehmende Verbreitung von digitalen Technologien und Anwendungen für einen Wachstumsschub. Mit 1,5 Prozent p. a. liegt das Wachstum der Branche merklich über dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum von 1,1 Prozent p. a. Produktivitätssteigerungen und der demografische Wandel führen dazu, dass die Erwerbstätigkeit trotzdem um 0,4 Prozent p. a. zurückgeht. Die Anzahl der Erwerbstätigen in der Gesamtwirtschaft geht zeitgleich um 0,3 Prozent p. a. zurück.